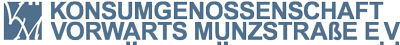Nach Verlagerung von KOMA wurde seitens der Stadt im Gebäudekomplex ein Flüchtlingsauffanglager eingerichtet, wie sie vielerorts typischerweise gerade in ehemaligen Kasernengeländen entstanden waren.
In den ersten Nachkriegsjahren waren tausende von Flüchtlingen und Vertrieben nach Wuppertal geströmt. Doch vor allem waren die östlich gelegenen deutschen Regionen belastet, in denen der Anteil von Flüchtlingen zum Teil bis zu 50 % an der Gesamtbevölkerung betrug.
In den Jahren nach 1949 war die Adenauer-Regierung, zu deren wichtigstem Verdienst die Integration der Flüchtlingsströme in die bundesrepublikanische Gesellschaft gehörte, bemüht, auch die weniger belasteten Gebiet im Westen Deutschlands bei der Umsiedlung zu berücksichtigen. Vor allem aus der sowjetisch besetzten Zone kamen in den Jahren nach 1950 ca. 500.000 Menschen.
Gerade nach dem Volksaufstand des 17. Juni 1953 in der DDR gelangten Flüchtlinge auf abenteuerlichen Wegen in den Westen. Die Flüchtlinge wurden zumeist von Berlin in das zentrale Auffanglager Hamburg-Bergedorf und von dort in bestimmte Städte in Westdeutschland, etwa nach Köln oder Wuppertal, geleitet. Wuppertal war wegen seiner Nähe zum Ruhrgebiet und den dort erhofften Arbeitsmöglichkeiten sehr beliebt. So lag hier in NRW die Arbeitslosigkeit unter den Vertriebenen in den Jahren 1950-1956 bei nur 11-12 %, während sie in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen 30-50 % erreichte. Vom Bahnhof ging es dann zum Auffanglager Münzstraße.